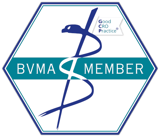Typ 1 Diabetes begleitet Betroffene ein Leben lang – und oft wird dabei vor allem über Blutzuckerwerte, Ernährung und Insulintherapie gesprochen. Doch was ist mit den Gedanken, Sorgen und emotionalen Belastungen, die der Alltag mit einer chronischen Erkrankung mit sich bringt?
Genau hier setzt Conni Söntgerath an. Sie ist Mentalcoach und hat selbst seit ihrem 19. Lebensjahr Typ 1 Diabetes. In ihrer Arbeit macht sie sichtbar, was viele nur mit sich selbst ausmachen: Schuldgefühle, Erschöpfung, Zukunftsängste – aber auch die Kraft, sich selbst neu zu begegnen.
Im Interview spricht sie offen darüber, warum mentale Gesundheit für Menschen mit Diabetes unverzichtbar ist, wie Partnerschaft, Beruf und Selbstbild mit der Erkrankung zusammenhängen und warum sie sich selbst nicht als „chronisch krank“, sondern als „chronisch stark“ bezeichnet.

Du lebst seit deinem 19. Lebensjahr mit Typ 1 Diabetes. Wann hast du gemerkt, dass es bei dieser Erkrankung nicht nur um Werte geht, sondern auch um mentale Stärke?
Als ich mit 19 die Diagnose bekam, war der Umgang mit Typ 1 Diabetes noch ein ganz anderer als heute. Damals hieß es: Die Werte müssen perfekt sein. Punkt. Man musste zu festen Zeiten essen, alles genau abwiegen und ein handschriftliches Tagebuch führen. Mehrfach täglich habe ich mir in den Finger gestochen, ohne wirklich zu verstehen, was in meinem Körper eigentlich passiert. Von Stress, Hormonen oder all den unsichtbaren Faktoren, die den Blutzucker beeinflussen, war nie die Rede. Also habe ich versucht, alles richtig zu machen. Perfekt zu funktionieren. Und wenn es dann trotzdem nicht klappte, kam die Enttäuschung – und die Erschöpfung, weil dieser Perfektionismus unglaublich viel Kraft kostet.
Der Wendepunkt kam, als der Kinderwunsch in meinem Leben konkret wurde. Mir wurde klar: So komme ich nicht weiter. Nur Kalorien zählen, wiegen, zur gleichen Zeit essen – das sind Spaßkiller, aber kein Weg, um wirklich stabil und zufrieden zu leben. Da habe ich verstanden, dass es mehr braucht als Zahlen und Regeln. Es braucht innere Stärke, einen anderen Umgang mit sich selbst – und den Mut, Perfektion loszulassen.Gab es einen persönlichen Wendepunkt, an dem du dich entschieden hast, als Coach anderen Betroffenen zu helfen?
Ja, der kam, als ich bei meinem heutigen Arzt erlebte, dass er wirklich Menschen behandelt und nicht nur Blutzuckerwerte. Zusammen mit anderen Betroffenen gründeten wir die Gruppe Pumpe+. Wir organisierten Symposien von Patienten für Patienten, mit Themen wie neue Therapien, Sport, Technik und Reisen. Meine Rolle war schnell klar – durch meinen Hintergrund als Trainerin und Coach war es für mich selbstverständlich, mich mit Gedanken, inneren Haltungen und unserer Wahrnehmung auseinanderzusetzen. Und das wurde zum zentralen Thema: Wie beeinflusst unser Denken unser Leben mit Diabetes?
Die Resonanz war beeindruckend. Teilnehmende trafen auf einmal Entscheidungen, für die sie vorher keinen Mut hatten: Sie wechselten Therapien, beendeten ungesunde Beziehungen oder fanden neue berufliche Wege. Der eigentliche Durchbruch geschah dort, wo Menschen ihre Gedanken überprüften und neue Sichtweisen entwickelten. Ganz nebenbei verbesserte sich bei vielen der HbA1c – wunderbar.
Ein Teilnehmer sagte mal zu mir: „Conni, ich bin seit Jahren wegen Depressionen und Diabetes in Behandlung. Aber das, was ich heute über unseren Verstand gelernt habe – das hätte mir so viele Therapien erspart.“ Solche Momente zeigen mir: Wir sind keine Maschinen. Wir sind Menschen – mit Sorgen, Ängsten, Hoffnungen. Gerade mit einem ständigen Begleiter wie Diabetes brauchen wir Wege, die über Technik hinausgehen. Das ist mein Antrieb.
Viele sehen Diabetes vor allem als körperliche Herausforderung. Wie würdest du die „unsichtbare“ mentale Dimension beschreiben?
Für mich ist die mentale Dimension die eigentlich entscheidende. Sie beeinflusst, welches Leben wir mit Diabetes führen können. Wenn ich mich selbst als „chronisch krank“ oder „behindert“ einordne, dann prägt das meine gesamte Wahrnehmung. Es sind Begriffe von außen, aber wenn ich sie übernehme, werden sie zu meiner Identität. Unser Verstand spielt hier oft Streiche. In Foren und auf Social Media sehe ich, wie viel Raum die Krankheit im Kopf einnimmt. Es geht ständig um Zahlen, Werte, Bolus- Rechnungen, aber selten um die eigentliche Frage: Wie will ich eigentlich leben – jenseits der Krankheit?
Auch Sprache ist machtvoll. Wir sagen: „Ich leide an Diabetes.“ Das legt eine Spur, die automatisch in Richtung Leid führt. Ich habe mich bewusst für eine andere Sprache entschieden – und das verändert alles. In meiner Arbeit zeige ich: Du bist mehr als deine Diagnose. Du darfst dein Leben gestalten – auch mit Diabetes. Genau das habe ich für mich selbst gelernt.
Welche inneren Belastungen begegnen dir bei Betroffenen am häufigsten – und vielleicht auch bei dir selbst?
Eine der größten Belastungen ist der Anspruch, dauerhaft gute Werte haben zu müssen. Hinter diesem Druck steckt oft die Angst vor Spätfolgen. Diese Angst treibt uns, kostet aber auch viel Kraft. Was oft vergessen wird: Viele entwickeln durch den Diabetes auch große Stärken – Disziplin, Ausdauer, Körperbewusstsein. Doch wir fokussieren uns meist auf das Schwere, nicht auf das Stärkende. Belastend ist auch, dass der Diabetes immer präsent ist – in Beziehungen, im Alltag, in der Intimität. Dazu kommt der Druck, im Beruf zu funktionieren, sich nicht „chronisch krank“ fühlen oder so wirken zu dürfen. Oft überträgt auch das Umfeld – Eltern, Partner, Freunde – unbewusst seine eigenen Ängste. Das kann den Druck noch verstärken. Und gerade Frauen erleben eine zusätzliche Belastung: Sie wollen Beruf, Familie und Krankheit gleichzeitig meistern, gute Vorbilder sein, stark wirken. Viele gehen dabei über ihre Grenzen – und verlieren sich selbst. Die innere „Mrs. Perfect“ lässt grüßen.
Welche mentalen Strategien oder Routinen helfen sofort, wenn Schuldgefühle oder Selbstzweifel hochkommen?
Das Erste: Aufhören, sich selbst mit der „siebensträngigen Spaghetti-Peitsche“ zu bestrafen. Sich Vorwürfe zu machen, weil ein Wert zu hoch war, bringt gar nichts. Es verstärkt nur den Stress. Stattdessen: Annehmen, was ist. Nicht gegen den Körper kämpfen, sondern fragen: „Okay, lieber Körper, wie kann ich dich jetzt unterstützen?“
Ich nutze bewusst Rituale. Achtsamkeit, Dankbarkeit – das sind keine Wellness-Klischees, sondern echte Anker. Ich erinnere mich oft daran, dass ich ohne Insulin gar nicht mehr leben würde. Ich bin dankbar für die Medizin, für mein Wissen, für die Möglichkeiten. Und es sind auch kleine, spielerische Dinge, die einen Unterschied machen – Ich tanze zum Beispiel jeden Morgen zu einem Lied, das ich mag. Keine „Hurra-Strategie“, sondern ein liebevolles Ritual, das mir guttut. Denn am Ende folgt der Körper dem Geist. Wenn ich mental klar bin, kann ich auch körperlich besser für mich sorgen.
Wie können Partner, Freunde oder auch Arbeitgeber Betroffene besser unterstützen?
Der erste Schritt ist: Sich selbst reflektieren. Warum handle ich gerade so? Kommt meine Reaktion aus Liebe – oder aus Angst? Bin ich als Partner überfürsorglich, weil ich mir Sorgen mache? Fühle ich mich als Arbeitgeber überfordert, weil ich an der Leistungsfähigkeit zweifle? Oder bin ich als Freund genervt, weil eine Aktivität länger dauert als geplant? Diese Ehrlichkeit sich selbst gegenüber ist zentral. Genauso wichtig ist es, dass Menschen mit Diabetes selbst klar kommunizieren, was sie brauchen. Eine einfache Bitte wie: „Stopp mal kurz, ich brauche eine Apfelsaftpause“ kann so viel bewirken – sie macht Bedürfnisse sichtbar, ohne Drama.
Ein schöner Leitsatz für Angehörige: „Was würde die Liebe jetzt sagen?“ Diese Haltung schafft Verbindung, auch wenn man die Krankheit selbst nicht erleben kann. Gleichzeitig muss klar sein: Die Verantwortung für den Umgang mit Diabetes liegt bei der betroffenen Person – nicht beim Partner, nicht bei den Eltern, nicht beim Chef. Diese Eigenverantwortung entlastet Beziehungen enorm. Denn ja, eine chronische Erkrankung wirkt wie ein Brennglas: Sie verstärkt, was sowieso schon da ist. Aber sie kann auch eine Chance sein, um Nähe, Ehrlichkeit und echte Verbundenheit neu zu entdecken.
Du hast „chronisch stark“ gegründet – was ist deine Vision damit und welche Botschaft möchtest du den Lesern mitgeben?
Chronisch stark® ist mein Gegenentwurf zu chronisch krank. Allein die Sprache macht schon einen Unterschied. Wenn ich morgens sage: „Wie kann ich heute chronisch stark sein?“, dann startet der Tag mit einer ganz anderen Energie. Chronisch stark zu sein ist eine Entscheidung. Es geht nicht um Trotz oder um den Beweis, dass man „alles kann“. Es geht um Selbstannahme. Um das Wissen: Ich habe Einfluss auf mein Leben, auch wenn ich nicht alles kontrollieren kann.
Ich habe irgendwann verstanden: Mein Körper hat Diabetes – aber er weiß das nicht. Er hat sich das nicht ausgesucht. Und genau deshalb macht es keinen Sinn, gegen ihn zu kämpfen oder mich in eine Opferrolle zu begeben. Ich frage mich stattdessen: Was kann ich heute tun, um chronisch stark zu sein? – Das ist ein innerer Kompass. Und diesen möchte ich weitergeben. Denn unser Kopf ist die Schaltzentrale. Was wir dort verändern, verändert unser ganzes Leben.
Welche Rolle spielt aus deiner Sicht die Teilnahme an klinischen Studien für Menschen mit Diabetes – auch im Hinblick auf das Gefühl, selbst etwas beizutragen?
Ich finde die Teilnahme an Studien sehr wertvoll – nicht nur medizinisch, sondern auch mental. Es ist eine Möglichkeit, aktiv beizutragen, Teil des Fortschritts zu sein. Ich selbst nehme regelmäßig teil, aktuell an einer Studie zur Nutzung von Apps und KI im Umgang mit Diabetes.
Studien sind essenziell, damit neue Therapien, Technologien und vielleicht irgendwann auch Heilungen möglich werden. Nur wenn Menschen bereit sind, sich zu beteiligen, kann echte Innovation stattfinden. Für mich ist das ein bisschen wie in der Politik: Wer sich nicht beteiligt, verschenkt Mitgestaltung. Und wer immer nur wartet, dass andere etwas verändern, bleibt passiv. Ich sehe das anders: Ich bin Teil dieser Gemeinschaft – also leiste ich auch meinen Beitrag.
Welche Tipps würdest du Menschen geben, die sich gerade überlegen, an einer Studie teilzunehmen und dabei vielleicht auch mentale Hürden spüren?
Mein erster Tipp: Benenne deine Hürde. Was genau macht dir Sorgen? Ist es die Angst vor Nebenwirkungen? Der Umgang mit Daten? Das Gefühl, „ein Versuchskaninchen“ zu sein? Oft ist es ein diffuses Unbehagen, aber sobald du es in Worte fassen kannst, kannst du auch aktiv damit umgehen.
Ich spreche gern von Ver-Antwort-ung: Du darfst deine Fragen ernst nehmen – und dann auch die passenden Antworten finden. Nicht alles einfach wegdrücken, sondern liebevoll hinschauen. In meinen Coachings machen wir das genauso: Wir holen Ängste aufs Papier, betrachten sie, nehmen sie an – und finden dann einen stimmigen Weg. Das Ergebnis kann Ja oder Nein heißen. Wichtig ist nur: Es ist deine Entscheidung – bewusst getroffen, aus der Klarheit heraus.
Und ganz ehrlich: Wer sich für andere einsetzt, darf auch mal für sich selbst mutig sein. Studienbeteiligung ist keine Selbstaufgabe – es ist Selbstwirksamkeit.
Vielen herzlichen Dank für das Interview!
Wenn Sie auch einen Beitrag leisten und an einer Studie bei Profil teilnehmen möchten, durchsuchen Sie gerne hier die Übersicht unserer aktuellen Studien.